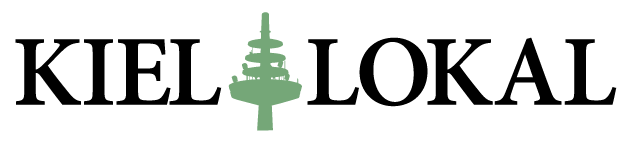Gedenktag anlässlich der Befreiung des „Arbeitserziehungslagers Nordmark“
Das „Arbeitserziehungslager Nordmark“(AEL), auch KZ Russee genannt, markiert ein düsteres Kapitel in der Kieler Stadtgeschichte. In der Zeit vom Juni 1944 bis zum 4. Mai 1945 unterstand das Lager der SS und Gestapo.
Als Teil eines Netzwerks von schätzungsweise 200 „Arbeitserziehungslagern“, die seit Ende 1940 im Deutschen Reich entstanden, diente das an der Rendsburger Landstraße (am Rand von Hassee und Russee) offiziell für die Durchsetzung von Arbeitsdisziplin. Die abschreckende Strafe sollte verdeutlichen, dass Arbeitsbummelei nicht geduldet wurde.
Doch der Alltag der Häftlinge, von denen etwa zwei Drittel aus Polen und der Sowjetunion stammten, war geprägt von unermesslichem Leid, Zwangsarbeit, Hunger und Angst. Die Inhaftierung erfolgte oft aus nichtigen Gründen, während die wahren Schrecken hinter den Lagermauern für die Öffentlichkeit verborgen blieben.
 Ein Grund zur Inhaftierung konnte sein, dass sich jemand negativ über seinen Vorgesetzten geäußert hatte, dem Arbeitsplatz ferngeblieben war oder aus Sicht des Arbeitgebers Arbeitsbummelei betrieb.
Ein Grund zur Inhaftierung konnte sein, dass sich jemand negativ über seinen Vorgesetzten geäußert hatte, dem Arbeitsplatz ferngeblieben war oder aus Sicht des Arbeitgebers Arbeitsbummelei betrieb.
Viele Kieler Unternehmen nutzten in der NS-Zeit die Gelegenheit, die Häftlinge als billige Arbeitskräfte einzusetzen. Dies, ohne die brutalen Bedingungen, unter welchen sie arbeiten mussten, zu hinterfragen. Die Insassen wurden zu gefährlichen und entwürdigenden Tätigkeiten gezwungen, die sie unter Bedingungen von extremer Erschöpfung und ohne angemessene Ernährung oder Unterkunft verrichten mussten.
Strafen für Ungehorsam waren überzogen und standen in keinem Verhältnis zu begangener Tat. Suchte ein ausländischer Zwangsarbeiter beispielsweise etwas Essbares im Müll, so musste er so lange Kniebeugen machen, bis er vor Erschöpfung nicht mehr aufstehen konnte.
Gewalt, Missbrauch und Tod waren an der Tagesordnung für jene, die sich den unmenschlichen Anforderungen nicht beugen konnten oder wollten. War es Erschöpfung, Versagen, Verweigerung oder gar Krankheit, es wurde nicht geduldet. Neben den offensichtlichen Methoden wie Gewalt, Vergewaltigung oder Tod kam auch die sogenannte „Weiße Folter“ zum Einsatz.
Als sich gegen Kriegsende die Tendenz abzeichnete, dass der Krieg nicht zugunsten der Nationalsozialisten ausgehen würde, wurde eine Großzahl der Häftlinge entlassen oder getötet. Einige Häftlinge wurden nur offiziell entlassen, aber in Wirklichkeit in andere AEL und KZs im Umkreis gebracht und dort getötet. Hier spricht man von den sogenannten „Todesmärschen“, die kurz vor Kriegsende ihren Höhepunkt erreichten.
Zwischen Juni 1944 und dem 4. Mai 1945 saßen zwischen 4.500 und 5.000 Häftlinge im Lager ein, von denen mindestens 578 im „Arbeitserziehungslager Nordmark“ den Tod fanden.
 Die Befreiung des Lagers in der Nacht auf den 4. Mai 1945 markierte das Ende dieser Gräueltaten, doch die Erinnerung an das Geschehene wurde in Kiel lange Zeit verdrängt.
Die Befreiung des Lagers in der Nacht auf den 4. Mai 1945 markierte das Ende dieser Gräueltaten, doch die Erinnerung an das Geschehene wurde in Kiel lange Zeit verdrängt.
Die Tatsache, dass Kinder in den Ruinen des Lagers spielten, ohne die Vergangenheit des Ortes zu thematisieren, spiegelt eine allgemeine menschliche Tendenz wider. Der Gedenktag des „Arbeitserziehungslagers Nordmark“ erinnert uns daran, dass wir die Schatten der Vergangenheit anerkennen müssen, um aus ihnen lernen zu können.
Am 4. Mai 2024 wurde der Opfer gedacht, die in den knapp elf Monaten, in denen das Lager betrieben wurde, hier der Gewalt, Willkür und dem Machtmissbrauch der SS und Gestapo ausgesetzt waren.
Die Landtagsabgeordnete Serpil Midyatli sowie die SPD-Politiker Mathias Stein und Oliver Vongehr berichteten über die Geschichte des Lagers, indem sie aus dem Buch
„Erziehung ins Massengrab“ von Detlef Korte vorlasen. Nebenher verkündeten sie, dass geplant sei, die Bushaltestelle „Strucksdiek“ in „Gedenkstätte Russee“ umzubenennen. Bewusst wurde auf die Begrifflichkeiten „Konzentrationslager“ oder „Arbeitserziehungslager“ verzichtet, um den durch den Nationalsozialismus geprägten Begriffen keinen öffentlichen Raum zu geben.
Es wird an eine effektive Beteiligung appelliert, wobei es um die Frage geht: Wie können wir die Gedenkstätte aufwerten und sichtbarer gestalten? Hierzu werden gern Ideen und Vorschläge entgegengenommen.
Die Zeitzeugen sterben aus und können nicht mehr aus erster Hand berichten. Doch wir sollten nicht vergessen, was vor knapp 80 Jahren passiert ist. Wenn der Mensch anfängt zu vergessen, so werden vergangene Fehler wiederholt, was (wie aktuelle Ereignisse in der Welt zeigen) zu fatalen Folgen führen kann. Doch wie schafft man es, sich zu erinnern? Nicht nur zu wissen, was passiert ist, sondern auch zu hinterfragen? Wie kann man Zeitgeschichte interaktiv, interessant und authentisch gestalten, sodass auch jüngere Generationen das Interesse an diesem Wissen nicht verlieren?
 Als Symbol für das Nicht-Vergessen wurde das Schild an der Rendsburger Landstraße, das auf die Gedenkstätte hinweist, geputzt. Dies wurde von Serpil Midyatli und Mathias Stein gemeinschaftlich durchgeführt, wobei sich beide auf die Leiter gewagt haben, um symbolisch jeweils eine Seite des Schildes zu putzen.
Als Symbol für das Nicht-Vergessen wurde das Schild an der Rendsburger Landstraße, das auf die Gedenkstätte hinweist, geputzt. Dies wurde von Serpil Midyatli und Mathias Stein gemeinschaftlich durchgeführt, wobei sich beide auf die Leiter gewagt haben, um symbolisch jeweils eine Seite des Schildes zu putzen.
Dieses dunkle Kapitel der Geschichte lehrt den Menschen unzählige Lektionen über die Tiefen menschlicher Grausamkeit, die Gefahren von Totalitarismus und die verheerenden Folgen von Hass und Diskriminierung. Indem man an diese Ereignisse erinnert, wird sich zu den Werten der Menschlichkeit, der Toleranz und der Demokratie bekannt.
Das Gedenken an die Opfer der NS-Zeit dient nicht nur denjenigen, die gelitten haben und deren Leben durch Rassismus, Willkür und Ideologie ausgelöscht wurden, sondern es hat auch eine wichtige präventive Funktion. Es erinnert uns daran, wachsam zu bleiben und die Anzeichen von Intoleranz, Rassismus und autoritären Tendenzen im Hier und Jetzt zu erkennen und dagegen anzukämpfen. Die Geschichte der KZ und AEL zeigt, zu welchen Extremen eine Gesellschaft fähig ist, wenn Hass und Hetze unkontrolliert Raum gegeben wird.
In einer Zeit, in der demokratische Werte zunehmend weltweit unter Druck stehen, ist die Erinnerung an die Schrecken der NS-Zeit ein mahnendes Beispiel, das die Notwendigkeit, für diese Werte einzutreten und sich gegen jede Form von Menschenfeindlichkeit zu engagieren, noch einmal verdeutlicht.JB